Hans-Heinrich Jörgensen
Ein
ausgewiesener Experte in Sachen Schüßler-Salz-Therapie. Jörgensen ist
Heilpraktiker seit 1962 und Vizepräsident des Biochemischen Bundes
Deutschlands. Viele Jahre war er Mitglied der wissenschaftlichen
Aufbereitungskommission für Mineralstoffe und Vitamine beim
Bundesgesundheitsamt.
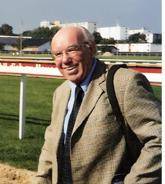
Das
Kalium-Mißverständnis
Säure-Basen-Haushalt
(Vortrag im Rahmen der
Medizinischen Woche Baden-Baden am 2.11.95)
von Hans-Heinrich Jörgensen
Das Kalium-Mißverständnis ist nur eines der vielen Mißverständnisse, die
sich wie ein roter Faden durch die Geschichte, Literatur und Diskussion des
Säure-Basen-Haushaltes ziehen. Ich will versuchen, einige davon ins rechte
Licht zu rücken. Am Kalium wird ganz besonders deutlich, wie leicht wir uns
durch die falsche Interpretation richtiger Beobachtungen aufs Glatteis führen
lassen.
Daß die "Übersäuerung" - ich setze das bewußt in
Anführungsstriche, denn in Wirklichkeit handelt es sich ja um einen Basenmangel
- zum krankmachenden Faktor geworden ist, hat sich inzwischen herumgesprochen.
Unsere Flüsse und Meere, unsere Wälder und Felder machen das fatal deutlich. Es
liegt auf der Hand, daß auch der Mensch nicht ungeschoren davonkommt.
Die naturheilkundlich orientierte Medizin hat das begriffen und sich des
Themas bemächtigt, leider nicht immer unter Berücksichtigung vorhandener
physiologischer Erkenntnisse. Ach, wäre es doch so einfach: Indikatorpapier in
den Urin, Kaisernatron zum Frühstück, und ein Speiseplan nach
"Säurewert-Tabellen". Wir hätten keine Probleme mit der Säure.
Aber bei dem Begriff Säure setzt schon der erste Klärungsbedarf
ein:
Lassen Sie mich in Erinnerung bringen, daß die Definition des Begriffes
"Säure" im Jahre 1923 eine grundlegende Änderung erfuhr. Bis dahin
galt die Arrhenius-Theorie, nach der im Wesentlichen Kationen und Anionen als
Basen und Säuren deklariert waren. Daher auch noch die chemisch nicht mehr ganz
treffenden Bezeichnungen Alkali-Metalle für Natrium und Kalium und Erd-Alkalien
für Calcium und Magnesium, obwohl diese Elemente an sich garnicht alkalisch
sind.
Broensted statt
Arrhenius
Seit 1923 gilt die Broensted-Theorie, nach der allein dissoziierte
Wasserstoff-Ionen (H+) als Träger der Säure gelten. Eine Säure ist
eine Verbindung, die H+-Ionen abgeben kann, eine Base ist eine
Verbindung, die sie wiederum aufnehmen kann. Erst in bestimmten Verbindungen
werden unsere Erd- und Metall-Alkalien zu säurebindenden Basen, z.B. wenn
Branntkalk (Calciumoxid = CaO) zu Löschkalk (Calciumhydroxid = Ca[OH]2)
reagiert.
Wie sauer eine Lösung ist, wird durch die Konzentration freier
Wasserstoff-Ionen bestimmt. Wegen der vielen Stellen hinter dem Komma drücken
wir die Konzentrationsangabe logarithmisch ohne das Minusvorzeichen aus, und
bezeichnen das als pH-Wert.
Wie jeder zu wissen meint, liegt der Neutralpunkt bei pH 7. Nur: das
gilt allein für mehrfach destilliertes Wasser. Schon Spuren irgendeiner Zugabe,
zum Beispiel die geringen Calcium- und Magnesiummengen unseres Trinkwassers,
machen aus dem Wasser eine Pufferlösung, die imstande ist, hinzukommende
Wasserstoff-Ionen, sprich Säuren, zu binden und damit ihrer Agressivität zu
berauben. Damit sind die H+-Ionen zwar nicht weg, aber sie schlagen
nicht mehr auf den pH-Wert durch.
Den echten Neutralpunkt, nämlich jenen pH-Wert, bei dem freie Basen und
Säuren gleichgewichtig im Verhältnis 1:1 vorliegen, bezeichnen wir als
Dissoziationskonstante oder - ebenfalls logarithmisch ausgedrückt wie beim pH -
als pK-Wert. Dieser wirkliche Neutralpunkt ist für jede Pufferlösung anders und
läßt sich durch eine - allerdings aufwendige - Titrationsreihe bestimmen.
Blut ist neutral bei pH 6,1
Im menschlichen Plasma beträgt der pK-Wert 6,1. Wir sind mit unserem
Blut-pH von ca. 7,4 also nicht "schwach basisch" sondern sogar sehr
stark basisch. Das macht deutlich, wo der Feind steht. Wenn denn der Schöpfer
uns 20mal mehr Basen als Säuren ins Blut gibt, dann spricht das für seine
Fürsorglichkeit, mit der er uns vor der bösen Säure zu schützen trachtet. Und
es macht ebenfalls deutlich, daß zwar Obacht geboten ist, aber kein Anlaß zur
Panik besteht.
Woher stammt diese Zahl 20 ? Nach dem Massenwirkungsgesetz und der
darauf fußenden Henderson-Hasselbalch-Gleichung bestimmt das Verhältnis freier
Basen zu Säuren den pH-Wert. Die Formel sollte man sich merken:
Base
pH = pK + log ----
Säure
Die Differenz zwischen pK 6,1 und dem normalen pH 7,4 ist - auch ohne
Taschenrechner schaffen wir das noch - 1,3. Da pH und pK logarithmische Werte
sind, müssen wir auch das Verhältnis Base zu Säure logarithmisieren. Und nun
dürfen Sie den Taschenrechner nehmen: 10 hoch 1,3 ist exakt 20, also muß
das Verhältnis Basen zu Säuren im Plasma 20:1 betragen.
Zwanzigmal mehr Basen als Säuren im Blut.
Blutgas-Automaten-Erfahrene werden das bestätigen:
HCO3- = 24 mmol/L, CO2-Konzentration, umgerechnet vom
Partialdruck, = 1,2 mmol/L, also 20:1
Nun mißt der Blutgas-Automat, wie der Name schon sagt, nur flüchtige
Säuren und dazu den pH-Wert, und errechnet aus diesen beiden dann nach obiger
Formel die Basenmenge des Blutes, ausgedrückt als base exzess, nämlich
Abweichung von 24 mmol/L. Außer den flüchtigen Säuren haben wir aber eine Reihe
nichtflüchtiger, z.B. Milchsäure, Brenztraubensäure usw. im Blut. Die angenommene
Basenmenge von 24 mmol/L ist darum auch nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich
sind wir mit einer Basenreserve von etwa 48 mmol/L ausgerüstet. Das läßt sich
beweisen: Titriert man mit Salzsäure Blut auf den pK 6,1 zurück,
verbraucht man ca. 46 mmol/L, also die ursprüngliche Differenz Base zu
Säure.
Das ist übrigens das Prinzip der Messung, die Sie im Kurs von
Dr.Worlitschek gestern kennengelernt haben.
Nicht der pH-Wert, die Pufferkapazität ist diagnostisch interessant
Wir legen im allgemeinen viel zu großen Wert auf die Bestimmung des
pH-Wertes. Der akuten Azidose begegnen wir nicht in der ambulanten Praxis. Sie
ist längst mit Blaulicht auf der Intensivstation gelandet, dem einzigen Ort, wo
derzeit Säure-Basen-Diagnostik betrieben wird.
Aber zwischen kerngesund einerseits und akuter Azidose mit Blaulicht
andererseits muß es doch eine Entwicklung gegeben haben, bei der wir unsere
Pufferreserven aufgebraucht haben.
Vor der akuten Azidose nach jedem schwefelsäurehaltigen Schnitzel schützen uns
die 48 mmol/L basischer Puffersubstanzen. Zur Azidose kommt es erst, wenn diese
erschöpft oder verbraucht sind.
Darum bewegt uns auch nicht die Frage nach dem pH-Wert des Blutes, der
innerhalb seiner Schwankungsbreite bei unseren Patienten immer normal ist.
Unsere diagnostische Frage heißt: Wie groß ist die Pufferkapazität?
Wir haben in unserem Hause ein Titrationsverfahren entwickelt, mit dem
sich erstmals diese Frage beantworten läßt. Dr.Worlitschek und andere, deren
Literatur Sie kennen, arbeiten damit.
Blut und Gewebe, oder extra- und intrazellulär ?
Und nun zu den Fehldeutungen, die aus den mißverstandenen
Wechselbeziehungen zwischen K+- und H+-Ionen entstanden sind.
Wir müssen uns zum besseren Verständnis vor Augen halten, daß die dissoziierten
Wasserstoff-Ionen und auch die Kalium-Ionen sich in drei verschiedenen
Kompartiments aufhalten, die unserer Messung unterschiedlich zugänglich
sind:
im
Intrazellulärraum,
im Extrazellulärraum,
im Urin.
Wir postulieren in der Naturheilkunde immer, überschüssige Säuren würden
aus dem Blut ins Gewebe abgeschoben. Diese Unterscheidung ist so nicht korrekt,
die Grenze ist die Zellmembran. Das Blut enthält auch "Gewebe", der
Muskel Extrazellulärflüssigkeit. Wir müssen also nicht zwischen Blut und
Gewebe unterscheiden, sondern zwischen intra- und extrazellulär.
Eine Ausnahme kann das kollagene Bindegwebe bilden, das eine große
Säure-Bindungskapazität hat und sich ähnlich wie der Intrazellulärraum
verhält.
Die Säure spielt Verstecken
pH-Messungen des Blutes, ob im Plasma oder Vollblut gemessen, erfassen
immer nur den Extrazellulärraum. Die Meßsonde dringt nicht in die Zelle ein.
Intrazelluläre H+-Ionen bleiben der Meßsonde des Arztes verborgen.
Und das ist die Falle, die so viele Irrtümer zur Folge hat.
Sie alle wissen, daß Kalium ein typisch intrazelluläres Kation ist, im
Zellinneren etwa 30-40mal höher konzentriert als draußen. Dieses
Konzentrationsgefälle hält u.a. das Ruhepotential der Nervenzellen aufrecht. Zu
Recht könnte man bei den vielen neuro-vegetativ labilen Patienten darum auch
sagen: "Kalium statt ....". - Es reimt sich zwar, aber ich möchte mir
keine einstweilige Anordnung einhandeln.
Bei einem Kaliummangel wandern zur Aufrechterhaltung der
Elektroneutralität statt der fehlenden K+-Ionen nun H+-Ionen
in den Intrazellulärraum ein. Und diese im Zellinneren versteckten H+-Ionen
werden von unserer Meßsonde nicht mehr erfaßt. Im Plasma sind sie verschwunden.
Da wir aber nur das Plasma messen, diagnostizieren wir als Folge des
Kaliummangels eine Alkalose. So steht es in fast allen Lehrbüchern der inneren
Medizin. Doch richtig ist das nur für das Plasma. In Wirklichkeit hat der
Kaliummangel-Patient sich jedoch eine intrazelluläre Azidose
eingehandelt.
Diese intrazelluläre Azidose ist deswegen so fatal, weil die hinter der
Zellmembran verschanzten H+-Ionen sich nicht nur der Meßsonde des
Arztes entziehen, sondern auch nicht mehr von den Meßfühlern der Niere zur
Kenntnis genommen werden. Die Kontroll- und Eliminations-Mechanismen des
Körpers versagen. Die intrazelluläre Säure wird weder erkannt noch
ausgeschieden. Der Urin wird alkalisch.
Auch beim Krebs diagnostizieren wir eine Alkalose des Blutes, ohne nach
dem Zellinneren zu fragen. Wir können hier sicher vom gleichen Irrtum ausgehen.
Warburg und Seeger haben vor vielen Jahren die These aufgestellt, die
Zellgärung würde zum Krebs führen - und wurden verlacht. Vielleicht ist ja doch
etwas dran, daß die intrazelluläre Azidose zum Verlust von Kontrollmechanismen
bei der Zellteilung führt ?
Burnell, Teubner und Simpson haben schon 1974 anhand verschiedener
Parameter aufgezeigt, was bei Hunden passiert, wenn dem Futter Kalium entzogen
wird: während einer kaliumfreien Diät sinkt im Plasma die HCO3--Konzentration,
weil nach dem Verschwinden der Säuren ins Zellinnere diese Base verstärkt
ausgeschieden wird. Im Urin sinkt die Netto-Säure-Exkretion und der pH
steigt.
Interessant wird das Geschehen aber erst, nachdem dem Futter wieder
Kalium zugesetzt wurde: die Säure-Exkretion steigt rapide an und der Urin-pH
sinkt tief in saure Bereiche.
Das zeigt deutlich, daß die sauren Valenzen im Körper versteckt waren und durch
die Kaliumzufuhr wieder aus ihrem Versteck vertrieben und der renalen
Elimination preisgegeben wurden. Eine wirksame "Entsäuerung"
setzt also zwingend Kalium voraus.
Getreide säuert nicht, es entsäuert
Damit entpuppt sich aber eine weitere in naturheilkundlichen Kreisen
weit verbreitete These als Irrtum, nämlich daß Getreide säuern würde. Das ist
auch in sich nicht sonderlich logisch.
Schon die Ärzte im alten Arabien wußten, daß Pflanzenasche = al kali
(lateinisch/englisch Potassium = Pottasche) etwas für den Stoffwechsel
bedeutsames enthält. Und jeder Vegetarier weiß heute, daß die pflanzliche
Ernährung den Urin alkalisch macht, eine Folge des reichen Kaliumgehaltes der
Pflanzen.
Warum sollte Getreide sich anders verhalten ?
Der obige Tierversuch, unwissentlich vieltausendfach an Menschen
wiederholt, macht deutlich, wie diese These entstanden ist. Wenn intrazellulär
übersäuerte Kaliummangel-Patienten auf Getreide-Ernährung umgestellt werden,
dann wird die Säure ausgetrieben. Der Urin wird sauer, aber nicht etwa weil
Getreide säuert, sondern weil es entsäuert. So schnell ziehen wir falsche
Schlüsse aus richtigen Beobachtungen.
Allenfalls stark eiweißhaltiges Getreide - z.B. Soja oder Hafer - kann
vom Eiweißgehalt her die Säurebilanz steigen lassen.
Kohlenhydrate verbrennen aerob vollständig zu CO2 und H2O.
Anaerob - jeder Sportler weiß das - hinterlassen sie Milchsäure, die die
Leistung limitiert. Und lassen Sie mich bei der Gelegenheit darauf hinweisen,
daß stoffwechselmäßig jeder Geriatrie-Patient ein Leistungssportler ist.
Übrigens wird die Milchsäure durch das manganhaltige Enzym Pyruvatcarboxylase
aus der Stoffwechselsackgasse befreit und wieder zu verbrennungsfähiger Glucose
verstoffwechselt. Zum Entsäuern ist also auch Mangan notwendig.
Die schwachen Säuren der Pflanzen schlagen wenig zu Buche. Der größte
Säuerungsfaktor in unserer Ernährung ist der Eiweißüberschuß. Bei einer
Ernährung mit 70 g Protein/die fallen bis zu 80 mmol H+-Ionen als
Schwefelsäure aus den Aminosäuren und als Phosphorsäure aus dem
Phospholipidstoffwechsel an. Wohlstandsbürger verzehren aber weitaus mehr
Eiweiß.
Auch sei nicht verschwiegen, daß wir mit einigen Medikamenten
beträchtliche Säuremengen ins Spiel bringen. Es läßt sich unschwer errechnen,
daß Acetylsalizylsäure bei der empfohlenen Dosis von 1000 mg/die ziemlich genau
200 mmol H+-Ionen freisetzen. Und auch die Ascorbinsäure bringt per
Gramm noch 100 mmol Säure.
Säurewert-Tabellen der Nahrungsmittel sind falsch
Die veränderte Broensted-Definition hat sich offenbar bis heute nicht
überallhin herumgesprochen. Darum auch diese Klarstellung:
Wir klammern uns an Tabellen, die vorgeben, uns den säuernden oder
alkalisierenden Wert der einzelnen Nahrungsmittel kundzutun. Bei allen Tabellen
bleibt es jedoch ein Geheimnis, wie sie zustande gekommen sind, und nach
welchen Verfahren die Analysen durchgeführt wurden. Wenn man die Spur von Zitat
zu Zitat zurückverfolgt, ist man schnell in der Zeit der Arrhenius-Theorie
gelandet. Tabellen über den Säure-Wert von Nahrungsmitteln, die aus der Zeit
vor Broensted stammen, spiegeln darum auch nur Kationen-Anionen-Bilanzen wieder.
Dies zudem unvollständig, denn bei nicht ausgeglichener Bilanz wäre das
Lebensmittel hoch ex- oder implosiv. Solche Tabellen haben keinen Wert.
Wenn wir unbedingt einen Weg suchen, unsere Nahrung in das Korsett
solcher Tabellen zu zwängen, dann müssen wir uns der
Henderson-Hasselbalch-Gleichung erinnern. Theoretisch ist es ganz einfach,
praktisch jedoch eine ungeheure Fleißarbeit. Wenn doch im Blut das
Base-Säure-Verhältnis 20:1 ist, dann hat jedes Nahrungsmittel, bei dem der
Quotient größer als 20 ist, basenspendenden Charakter. Wir brauchen also nur
den pH-Wert zu messen und den pK-Wert zu titrieren, gelöster Zustand
vorausgesetzt. Ist die Differenz größer als 1,3 (log 20), dann haben wir einen
Basenspender.
Ich hoffe, dieser Hinweis trägt dazu bei, daß an einem
ernährunsgwissenschaftlichen Institut ein paar Doktoranden sich der Sache
einmal annehmen.
Und damit komme ich zum letzten Zahn, den ich ziehen muß:
Urin-Kontrollen sind
nur bedingt tauglich
Die tägliche mindestens anfallenden 80 mmol Säure müssen über die Nieren
ausgeschieden werden. Die vielgepriesene Atmung als Regulans kann nur den pH
des Blutes verschieben, nicht aber die Säure-Basen-Bilanz insgesamt verbessern.
Im Gegenteil: eine respiratorische Alkalose geht paradoxerweise mit einem Basenmangel
einher.
Und nun rechnen Sie einmal mit:
pH 0 entspricht 1 mol/L, pH 3 folgerichtig 1 mmol/L und pH 4 nur noch 0,1
mmol/L. Bei einer Urin-Ausscheidung von ca. 1,5 Liter pro Tag, angenommen ein
extrem saurer Urin mit pH 4, werden also nur 0,15 mmol dissoziierte H+-Ionen
insgesamt pro Tag ausgeschieden, die den pH bestimmen. Tatsächlich verlassen
den Körper über die Nieren aber mindestens 80 mmol Säure pro Tag, und zwar in
Form von NH4+ oder als titrierbare Säure, eingebunden in
anderen puffernden Molekülen, die sich nicht im pH-Wert widerspiegeln. Wieder
ist eine Illussion geplatzt, nämlich daß pH-Kontrollen des Urins eine sinnvolle
Aussage über den Säure-Basen-Haushalt geben könnten.
Und auch dieses macht die Urinkontrolle so anfällig:
Wenn schon die sauren Valenzen des Intrazellulärraumes sich nicht im Plasma
zeigen, dann natürlich noch viel weniger im Urin. Ein gefährlich übersäuerter
Patient hat einen wunderbar alkalischen Urin. Und wenn denn schließlich eine
wirksame Entsäuerung einsetzt, z.B. durch Kaliumgaben, dann wird logischerweise
der Urin sauer, wir aber geraten in Sorge, anstatt zu frohlocken.
Aber auch eine extrazelluläre Übersäuerung im Plasma spiegelt sich nur
dann im Urin wieder, wenn die Niere für die Säure durchlässig ist. Die
Säureausscheidung wird an der Niere durch das zinkhaltige Enzym Carboanhydrase
gesteuert. Ist dieses Enzym inaktiv, z.B. durch einen Zinkmangel oder durch den
Einsatz von Diuretika vom Typ Carboanhydrasehemmer, dann bleibt die Säure im
Plasma und gelangt nicht in den Urin. Auch Zink gehört also zu einer wirksamen
Entsäuerung.
(Ein Wort pro domo: Die drei Elemente Kalium, Zink und Mangan, sowie
eine ganze Reihe wirksam puffernder Substanzen finden Sie übrigens in jenem
Produkt, dessen Anzeige im Programmheft auf Seite 194 direkt unter dieser
Vortragsankündigung steht. Neukönigsförder
Mineraltabletten)
Säure-Basen-Diagnostik kann sinnvoll nur im Blut erfolgen.
Wenn schon Urin zur Untersuchung herhalten soll, dann allenfalls mit dem von
Sander beschriebenen Verfahren, bei dem in sechs Urinproben des Tages mit
Evakuierung und mehrfachen Titrationen nach oben und unten in einem sehr
aufwendigen Arbeitsgang die Netto-Basen-Exkretion des Tages gemessen wird.
Meines Wissens wird das nur noch in zwei Laboratorien praktiziert.
Für die Praxis könnte allenfalls ein Suchtest in Frage kommen, den van
Slyke schon 1902 beschrieben hat: morgens einen guten Eßlöffel Kaisernatron
einnehmen. Im Laufe der nächsten Stunden muß der Urin dann einen deutlichen
Schub ins Alkalische machen. Tut er das nicht, können Sie von einer
Übersäuerung ausgehen. Das Blut gibt den dringend benötigten Bikarbonatstoß um
keinen Preis wieder her.
***********************
Ich weiß, ich habe eine Menge liebgewordener Theorien auf den Kopf
gestellt und vieles, was Sie allenthalben hören und lesen, in Zweifel gezogen.
Hoffentlich reagieren Sie dieserhalb nun nicht sauer.
Danke fürs Zuhören.